Der Begriff „Ressource“ stammt aus dem Französischen. Damit werden bestimmte Mittel bezeichnet, die nötig sind, um ein Ziel zu erreichen. Von „natürlichen Ressourcen“ wird gesprochen, wenn Landschaftselemente wie Seen oder Wälder, aber auch Rohstoffe wie Öl, Gas oder Holz gemeint sind.
Auch in Gebäuden stecken Ressourcen. Welche genau? Das haben wir Prof. Dr. Sabine Flamme und Dr. Franziska Struck vom IWARU - Institut für Infrastruktur, Wasser, Ressourcen, Umwelt der Fachhochschule Münster gefragt sowie Dr. Jan Wenker, Abteilungsleiter Nachhaltigkeit und Innovation bei der Brüninghoff Group in Heiden, und Klaus Dosch, Geschäftsführer der ResScore GmbH.
Welche Ressourcen stecken in einem Gebäude?
Prof. Dr. Sabine Flamme und Dr. Franziska Struck: „In einem Gebäude sind verschiedene Rohstoffe wie Beton, Ziegel, Holz oder Kunststoffe in Baukonstruktionen verbaut. Sie lassen sich nach ihrer Art zum Beispiel in mineralische, fossile und nachwachsende Baustoffe einteilen.“
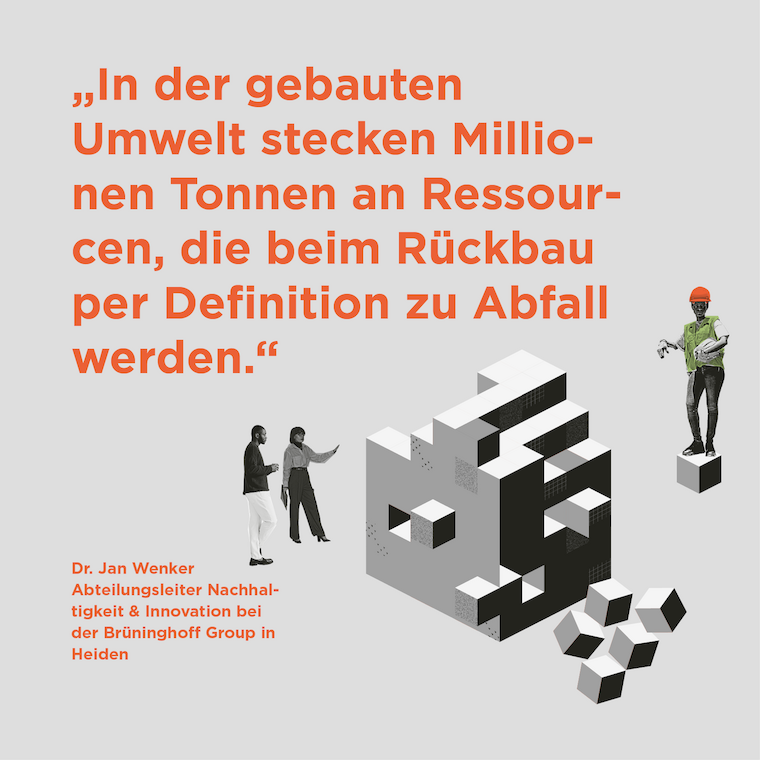
Dr. Jan Wenker: „Die knappe Antwort: unglaublich viele! In der gebauten Umwelt stecken Millionen Tonnen an Ressourcen, die beim Rückbau per Definition zu Abfall werden. Es ist derzeit unglaublich schwierig, diese Ressourcen wieder in neuen Gebäuden zu verbauen. Zumeist geschieht leider ein Downcycling. Um Ressourcen nicht erst zu Abfall werden zu lassen, sollte Bauen im Bestand [Umbau, (serielle) Sanierung, Aufstockung, Umnutzung] und der Einsatz von Sekundärbaustoffen Vorrang haben.“
Klaus Dosch: „Wenn es gut läuft, gibt es rezyklierte, sekundäre Rohstoffe. Und in der Senkenfunktion der Ressourcen natürlich Treibhausgase, die in die Atmosphäre gelangen. Außerdem wird Boden versiegelt.“
Welche Methoden gibt es zur Einordnung und zum Vergleich dieser in Gebäuden gebundenen Ressourcen (Rohstoffe, Baustoffe oder Materialien)?
Dr. Jan Wenker: „Zur Einordnung der Ressourcen in der urbanen Mine sind Gebäude-Ressourcenpässe ein wichtiges Instrument. Bei Neubauten sollte grundsätzlich ein Ressourcenpass erstellt werden, Bestandsgebäude müssen digital nacherfasst werden.“
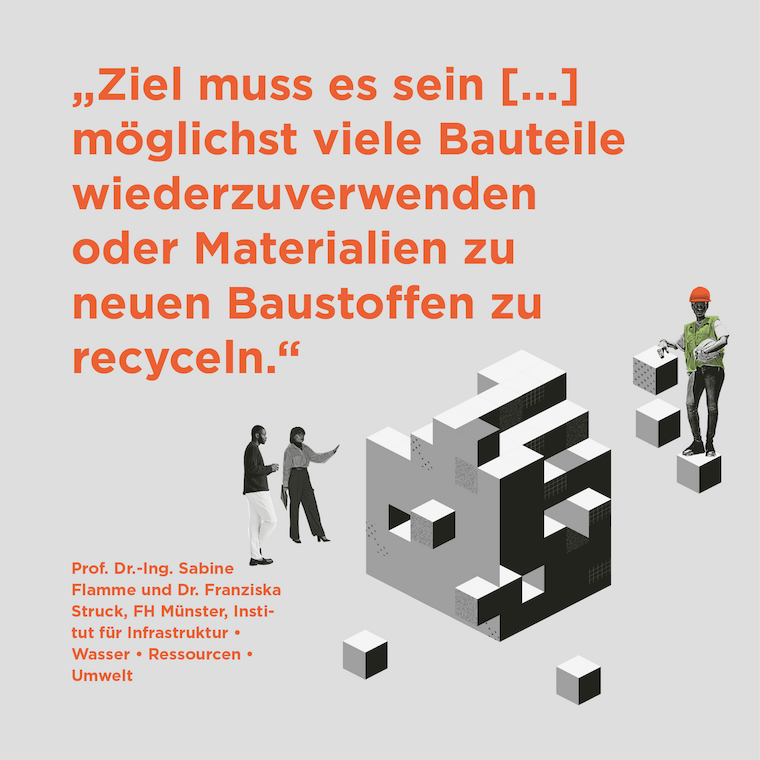
Prof. Dr. Sabine Flamme und Dr. Franziska Struck: „Es kann außerdem eine Bewertung nach dem Gehalt an grauer Energie, dem CO2-Fußabdruck, dem Ressourcenrucksack, dem Schadstoffgehalt oder der Wiederverwendungs- oder Recyclingfähigkeit erfolgen. Ziel muss es sein, den Wert der Baustoffe zu erhalten und möglichst viele Bauteile wiederzuverwenden oder Materialien zu neuen Baustoffen zu recyceln.“
Klaus Dosch: „Bislang gibt es in der Ökobilanz beim Bauen im Unterschied zu Treibhausgasen, Boden oder Wasser keinen geeigneten Indikator für Rohstoffe. In Frage kommen hier nur der Rohmaterial Input und der Kumulierte Materialaufwand. Diese Indikatoren messen den Rohstoffbedarf über die gesamte Wertschöpfungskette. Wir nutzen diese Indikatoren schon lange.“
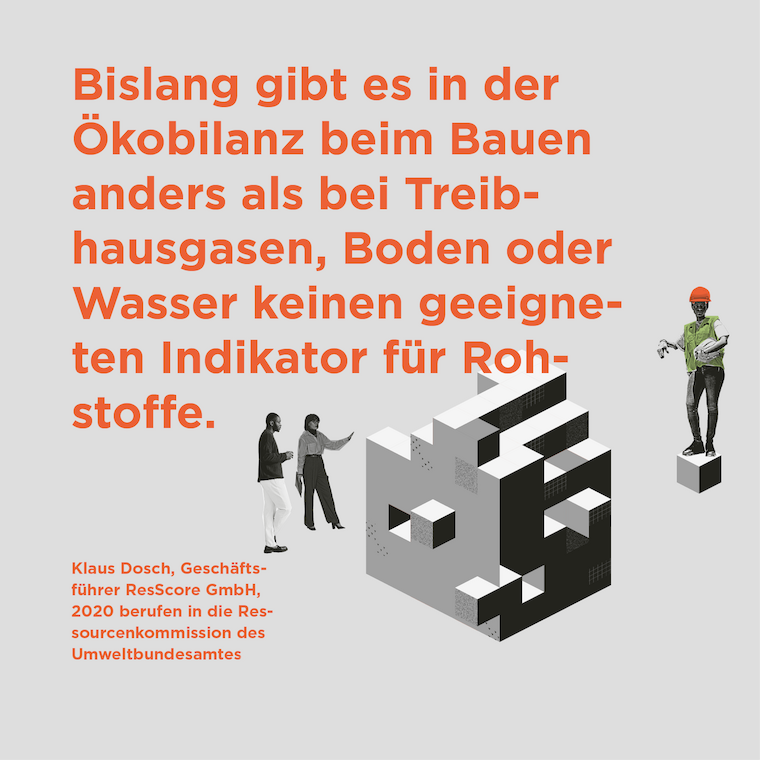
Mehr zum Thema „UmBauLabor“ finden Sie in unserem Pageflow. Das Pageflow ist die multimediale Plattform für das „UmBauLabor“. Es veranschaulicht sowie dokumentiert das Projekt und wird fortlaufend aktualisiert.


